Fiction Victims und die Dringlichkeit der Form
Der „Kölner Kongress“ zum Thema „Erzählen in den Medien“
Zu viele Besucher, zu kleine Säle, zu eng getaktete Vorträge – wenn man Grund hat, sich über so etwas zu beschweren, dann kann es sich nur um einen Erfolg auf ganzer Linie handeln. Beim jetzt zum ersten Mal veranstalteten „Kölner Kongress“, der vom Deutschlandfunk (DLF) in Zusammenarbeit mit der Kunsthochschule für Medien (KHM) ausgerichtet wurde, platzte am 10. und 11. März das Erdgeschoss des DLF-Funkhauses am Kölner Raderberggürtel aus allen Nähten. „Erzählen in den Medien“ war das Thema und im Fokus stand hauptsächlich das Erzählen im nicht-fiktionalen Bereich.
Seit im Oktober 2014 die amerikanische Journalistin Sarah Koenig mit ihrer Podcast-Serie „Serial“ einen realen Mordfall nachrecherchierte und für den mutmaßlichen Täter eine Wiederaufnahme des Verfahrens erreichte, erfreut sich das Genre gewaltiger Aufmerksamkeit. Bis Februar 2016 wurde Koenigs Podcast über 80 Millionen Mal heruntergeladen, inzwischen dürfte die 100-Millionen-Marke geknackt sein. Kein Wunder, dass sich Programmverantwortliche des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nach einem „deutschen Serial“ sehnen, wie auch nach einem deutschen „Breaking Bad“ oder nach etwas, was man sonst noch so abkupfern kann, wenn einem der Mut zu eigenen Ideen fehlt.
Die maximale Verführung
Zum offiziellen Auftakt des „Kölner Kongresses“ gab es dann gleich eine (zeitversetzt auch im DLF-Programm übertragene) Diskussionsrunde mit den deutschen Autoren serieller Formate, die sich alle mehr oder minder im Bereich „true crime“ bewegen. Anouk Schollähn recherchierte für das Format „NDR 2 – Täter unbekannt“ einer verschwundenen Frau hinterher. Philip Meinhold verarbeitete 2015 für den Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) einen Mord, bei dem ein rechtsextremistischer Hintergrund vermutet wurde, zu der PodcastSerie „Wer hat Burak erschossen?“, die auch in den RBB-Programmen Radio Eins und Kulturradio gesendet wurde. 2017 spürte Meinhold für die NDR/RBB-Koproduktion „Bilals Weg in den Terror“ dem Leben eines Teenagers nach, der für die Terrororganisation „Islamischer Staat“ in Syrien kämpfte und starb. Sven Preger und Stephan Beuting schließlich machten sich 2017 für den WDR in der Doku-Serie „Der Anhalter“, ausgestrahlt bei WDR 5, auf die Suche nach einem Menschen, der auf Autobahnraststätten nach Mitfahrgelegenheiten in die Schweiz sucht, um sich dort mit Hilfe der Organisation „Exit“ das Leben zu nehmen.
Kennzeichen vieler dieser Serien ist ein leeres Zentrum, weil ihr Protagonist entweder tot, verschwunden oder nur schwer erreichbar ist. Diese Leerstelle zu füllen, ist für jeden recherchierenden Journalisten die maximale Verführung, weil er hier auch als Presenter seiner selbst fungieren kann. Sarah Koenigs Eingangsstatement des „Serial“-Podcasts wurde denn auf dem DLF-Kongress auch gleich von drei Referenten im O-Ton zitiert. Dass in diesen Formaten zu einer journalistischen Herangehensweise auch eine dramaturgische Denke gehört, explizierte Sven Preger. Und dabei ging es nicht nur um die obligatorischen Cliffhanger am Ende jeder Episode oder die direkte Ansprache des Hörers nach dem Vorbild US-amerikanischer Radioshows, sondern um die gesamte narrative Struktur einer Podcast-Serie.
Das Spezifische einer Erzählung
Da es im öffentlich-rechtlichen Rundfunkföderalismus hierzulande ein umfangreiches Angebot von Feature-Formen im linearen wie im abrufbaren Radio gibt, konnten die Podcasts nicht-fiktionaler Serien nicht annährend den Rezeptionserfolg von „Serial“ erreichen. Nur in Dänemark, wo 2007 bei der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt Danmarks Radio (DR) das Feature abgeschafft worden war und nun seit einiger Zeit mühsam wieder aufgebaut wird, konnte sich eine relevante und publikumswirksame Podcast-Szene aufbauen. Referent Tim Hinman von der dänischen Audioproduktionsfirma „Third Ear“ gewann mit der Serie „Ringbindsattentatet“ („Der Aktenordner-Attentäter“) im Oktober 2016 den Prix Europa in der Kategorie „Digital Audio“ (vgl. MK 22/16).
Was aber unterscheidet nun eine Erzählung von anderen Formen von Mitteilung und Kommunikation?, fragte sich der Kulturtheoretiker Georg Seeßlen in seinem Vortag „Was bisher geschah … wird wieder geschehen“ und: Wie hat sich das Erzählen transformiert und wo liegen seine Grenzen? Eine Erzählung, so Seeßlens These, sei eine Mitteilung über Vorgänge, „die jenseits des aktuellen gemeinsamen Erfahrungs- und Bildraums liegen“. Durch die Erzählung werde der Rezipient in ein „Anderswo“, „Anderswann“ und „Anderswie“ entführt. Wenn zusätzlich noch „Anderswer“ die Geschichte weitererzähle, werde sie zur Überlieferung und diene auch der Gemeinschaftsbildung. Das Christentum sei in dieser Lesart ebenso eine Erzählgemeinschaft, wie „Anhänger von Rote Brause Leipzig“ eine bildeten.
Ein Plädoyer für Zwischengeschichten
Der sogenannte „Iconic Turn“, in dem die bildgebenden Verfahren die Herrschaft über das vorher wortbasierte Erzählen übernahmen, erzeugt laut Seeßlen einen narrativen Überschuss manipulativer Bilder – der gegenwärtig durch virtuelle Realitätsgadgets wie Datenbrillen und Datenhandschuhe Erzählungen an das einzelne Subjekt adressierbar macht. Mit der Vermischung von Erleben und Erzählen, so Seeßlen, sei das Ende des Erzählens erreicht, weil es kein Anderswo, kein Anderswann, kein Anderswie und qua Immersion keine Möglichkeit der Überschreitung des eigenen Erfahrungsraums mehr gebe. Für besonders schlimm hält Seeßlen das aber nicht, denn im Lauf der Geschichte der Ästhetik habe es schon viele Enden des Erzählens gegeben und die subversive Kraft der Sehnsucht nach dem Anderswo führe quasi notwendig zur narrativen Überschreitung des Diskursiven. Seeßlen weiter: „Eine realistische Erzählung ist nicht jene, die vorgibt, möglichst direkt und kritisch die Wirklichkeit wiederzugeben, sondern eine, die möglichst vieles offen, ambivalent und entfernt sieht.“
Daran anschließend plädierte aus kulturpraktischer Sicht die Schriftstellerin und Hörspielautorin Kathrin Röggla für „Zwischengeschichten“, nämlich eine Form von Erzählungen, die den „1000 politischen, wirtschaftlichen, unternehmerischen Fiktionen, die strategisch von PR-Beauftragten und Politikberatern entworfen werden, um politische, wirtschaftliche, unternehmerische Durchschlagskraft zu erzeugen“, nicht noch eine weitere hinzufügt.
Für Rögglas Texte, die aufgrund ihrer umfangreichen Recherche immer eine hohe Welthaltigkeit aufweisen, ist das Erzählen von Zwischengeschichten ein Form-/Inhalt-Problem. Denn wo Realität und Fiktion ineinander übergehen, braucht es eine Form, um das Abbildungsverhältnis deutlich zu machen. Dabei hat sich für Kathrin Röggla der Konjunktiv als sehr brauchbar erwiesen, ebenso wie verschobene Zeitlichkeiten und Referenzen auf abwesende Figuren – jene „Anderen“, die zugleich anwesend und abwesend seien, wie zum Beispiel die Entourage aus Dolmetschern, Protokollanten und Sicherheitsbeamten, die bei sogenannten Vier-Augen-Gesprächen im politischen Raum invisibilisiert werden.
Keine Lust auf Immersion
Für Kathrin Röggla ist es an der Zeit, „die Dringlichkeit der Form wieder zu befragen, nachdem man sie als allzu modern verabschiedet hat. So schwer dies theoretisch zu beschreiben ist, so plausibel wird ihre Erscheinung sein“, ist Rögglas optimistische Prognose. Die Vorträge, die Georg Seeßlen und Kathrin Röggla in Köln gehalten haben, sind jeweils in einer eigens im Studio produzierten Version in der DLF-Reihe „Essay und Diskurs“ gesendet worden und im Internet-Angebot des Deutschlandfunks nachzuhören (und die Texte sind dort auch nachzulesen).
Neben den vielen Vorträgen, Workshops, Diskussionsrunden und Hörinstallationen, neben dem Live-Feature „Freitagabend um zehn nach Acht in Deutschland“ von Tina Klopp und Johannes Nichelmann, dem Live-Hörspiel „In darkness let me dwell – Lieder aus der Finsternis“ des Duos Merzouga und neben dem Textkonzert „Alle wollen das“ von Jörg Albrecht blieb es einem überlassen, den impliziten Grundkonsens der Teilnehmer des „Kölner Kongresses“ in Frage zu stellen: Es war der Feature-Redakteur Ingo Kottkamp vom Deutschlandradio Kultur, der in seinem Vortrag den Imperativ der „Fiction Victims“ (eine Analogiebildung zu „Fashion Victims“, deren Lebensinhalt die Mode ist), dass auch im nicht-fiktionalen Bereich immer erzählt werden müsse, nicht a priori akzeptieren wollte. Er habe „keine Lust auf Immersion“, keine Lust also auf jenes Phänomen, durch das der Rezipient ganz von der Erzählung absorbiert wird. In seinem kursorischen Blick über die Geschichte des Radiofeatures stellte Kottkamp die Vielfältigkeit des Erzählens im Hörfunk vor.
Vor diesem Hintergrund ist es ein bisschen traurig, dass junge Radiomacher in Unkenntnis der Geschichte ihres eigenen Mediums meinen, das Rad als Podcast neu erfunden zu haben. Dass sich der „Kölner Kongress“ auf beachtlichem Reflexionsniveau der Zukunft des medialen Erzählens gestellt hat, lässt hoffen, dass diese Veranstaltung nicht die letzte ihrer Art bleiben wird.
Einen sehr schönen Zusammenschnitt der Veranstaltung von Anna Panknin gibt es hier nachzuhören. und eine Zusammenfassung der englischsprachigen Beiträge von Wolfgang Schiller hier.
Entdecke mehr von Hoerspielkritik.de
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.
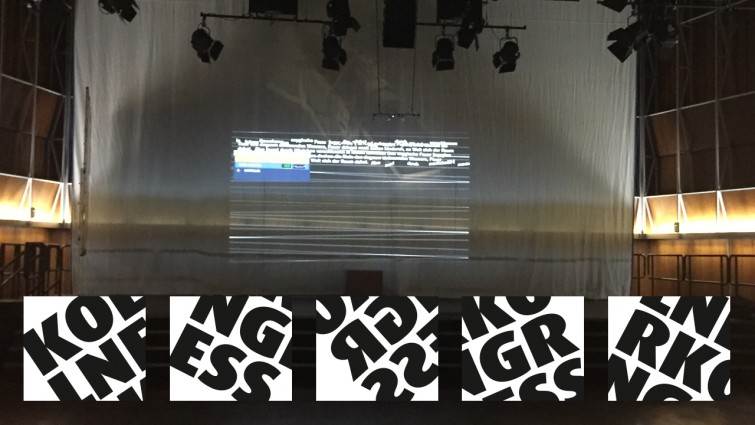
Kommentar verfassen